
Erschienen in Heft 2/2020 Quartiersentwicklung und Wohnungswirtschaft
Quartiersentwicklung. Soziale Quartiersentwicklung. Soziales Management. Quartiersmanagement. Stadtteilmanagement. Kiezkoordination. Begrifflichkeiten, die verwendet werden, wenn es darum geht, eine Überschrift dafür zu finden, dass sich kommunale Wohnungsunternehmen in ihren Wohnquartieren über die eigentliche Bestandsbewirtschaftung hinaus engagieren und neben der Bereitstellung von Wohn- und Gewerberaum soziale Verantwortung für das "Drumherum" übernehmen. Die Erwartungshaltung an die kommunale Wohnungswirtschaft ist, dabei wirtschaftlich zu agieren, gleichzeitig gesellschaftlich zu wirken und zudem (wechselnde) politische Forderungen zu erfüllen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport
Das Programm Sozial Stadt soll in benachteiligten Quartieren einer drohenden Abwärtsspirale entgegenwirken und Impulse für ein integratives Wohnumfeld schaffen. Auf der Grundlage von sogenannten Quartierseffekten wurde dieser Benachteiligung aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus ein theoretischer Rahmen erarbeitet. In einer umfangreichen Diskussion - über mehrere Jahrzehnte hinweg - wurde den verantwortlichen Akteuren aus Politik und Verwaltung somit ein theoretisches Modell zur Verfügung gestellt, das heute als Ausgangspunkt für zahlreiche Förderprogramme und Investitionen dient. In diesem Artikel soll daran anschließend diskutiert werden, ob sich die entsprechenden Effekte, die aus dem Raum heraus auf die betroffenen Bewohner wirken, statistisch überhaupt valide erfassen lassen.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2013 Diversität und gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Stadt
"Wem gehört die Stadt?" Diese Frage wird seit einiger Zeit immer öfter gestellt. Spätestens mit den Protesten gegen "Stuttgart 21" ist deutlich geworden, dass der Unmut über manche Fragen der Stadtentwicklung mittlerweile weite Bevölkerungsteile umfassen kann und auch mit Nachdruck artikuliert wird. Veränderungen – so hat es den Anschein – werden zunehmend mit Skepsis betrachtet; alles soll so bleiben, wie es ist. Doch so war es noch nie. Die gesamte Geschichte der Stadt ist eine Geschichte stetigen Wandels. Dieser Wandel wird häufig von privaten Investitionen angestoßen und kann im Weiteren von der Stadtplanung kaum vollumfänglich gesteuert werden. So vollziehen sich auch weniger bewusst bzw. zielgerichtet Prozesse, die im Laufe der Zeit zu gravierenden Veränderungen von Teilräumen in der Stadt führen können. Kommt es dabei zu einer allgemeinen Aufwertung, in deren Folge sich die Sozialstruktur des Quartiers verändert, wird gemeinhin von Gentrifizierung gesprochen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2020 Klimaanpassung im Stadtquartier

Erschienen in Heft 3/2023 Wohneigentum als Baustein für die Wohnungspolitik
Experimente gewinnen zunehmend an Bedeutung, um aktuelle Fragen der Stadtentwicklung zu adressieren. In diesem Beitrag wird zunächst die Projektreihe „Probewohnen“ vorgestellt, die seit 2008 in der Stadt Görlitz etabliert ist. Daran anschließend wird ein Überblick über Wohnexperimente in Deutschland in ähnlichen Konstellationen gegeben, eine systematische Einordung vorgenommen und reflektiert.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2023 Bildung in der Stadtentwicklung
Am 1. Juni 2023 war es wieder so weit: Der renommierte Preis Soziale Stadt wurde bereits zum 12. Mal seit seiner Erstauslobung im Jahr 2000 vergeben. Rund 100 Gäste versammelten sich im Umweltforum in Berlin-Friedrichshain und ehrten die fünf von der Jury ausgewählten Projekte aus ganz Deutschland. Über 100 Projekte wurden im Wettbewerb Preis Soziale Stadt 2023 eingereicht, von denen die Jury 16 in die sogenannte "engere Wahl" berief.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2020 Perspektiven für Klein- und Mittelstädte
Politische Gleichheit ist ein zentrales Kriterium einer lebendigen Demokratie. Das heißt, allen Bürgerinnen und Bürgern sollten die gleichen Möglichkeiten gegeben sein, sich eine politische Meinung zu bilden, diese frei zu äußern und sich an demokratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Es zeigt sich allerdings, dass mit zunehmender sozialer Ungleichheit und migrationsbedingter Diversität auch die politische Gleichheit abnimmt. Gerade in benachteiligten Stadtteilen sind daher die lokale Demokratie und die Integrationsfähigkeit demokratischer Prozesse besonders zu stärken. Eine Gemeinwesenarbeit, die niedrigschwellige und diversitätssensible Teilhabemöglichkeiten schafft, kann hier maßgeblich zu einer Demokratisierung von Kommunikations- und Partizipationsstrukturen beitragen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2018 Gemeinwohlorientierung in der Bodenpolitik
„Fehlendes Bauland ist der Flaschenhals für mehr Wohnungsbau“. Wohnungsbauministerin Priska Hinz brachte es im März 2017 auf den Punkt: Um den Mangel an bezahlbaren Wohnungen wirkungsvoll bekämpfen zu können, braucht es neben finanziellen Mitteln vor allem baureife Grundstücke. Mit der Bauland-Offensive Hessen GmbH haben das Land Hessen und die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt ein Instrument geschaffen, das die Kommunen bei der raschen Baulandentwicklung unterstützt und diesen Flaschenhals aufbricht. Ein gutes Jahr nach der Gründung zog Hinz ein zufriedenes Zwischenfazit. „Es gab bislang 44 Anfragen aus hessischen Kommunen. Vier Machbarkeitsstudien sind fertig, zehn weitere in Bearbeitung.“ Für die Studien stellt das Land Fördermittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro zur Verfügung.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2016 Stadtentwicklung und Sport
Sucht man einen Anknüpfungspunkt aus der Theorie, von dem aus beschrieben werden kann, wie sich die soziale Welt grundlegend verändert hat, bietet sich der Diskurs zur Postmoderne an. Dabei ist es alles andere als eindeutig, was mit diesem Begriff gemeint wird. Ein wichtiger Denker der Postmoderne, der polnisch-britische Philosoph Zygmunt Bauman, verdeutlicht, dass diese Uneindeutigkeit bereits typisch ist für den Charakter „des Postmodernen“, denn: „Summa summarum zeigt sich der postmoderne Geist weniger als sein moderner Konkurrent von der Idee begeistert (und schon gar nicht von dem Drang besessen), die Welt in ein Gitter sauberer Kategorien und klar umrissener Einteilungen zu sperren“ (Bauman 1999, S. 295). Im Gegenteil: postmoderne Lebensentwürfe zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Festlegung von Identitäten geradezu vermeiden.
Beiträge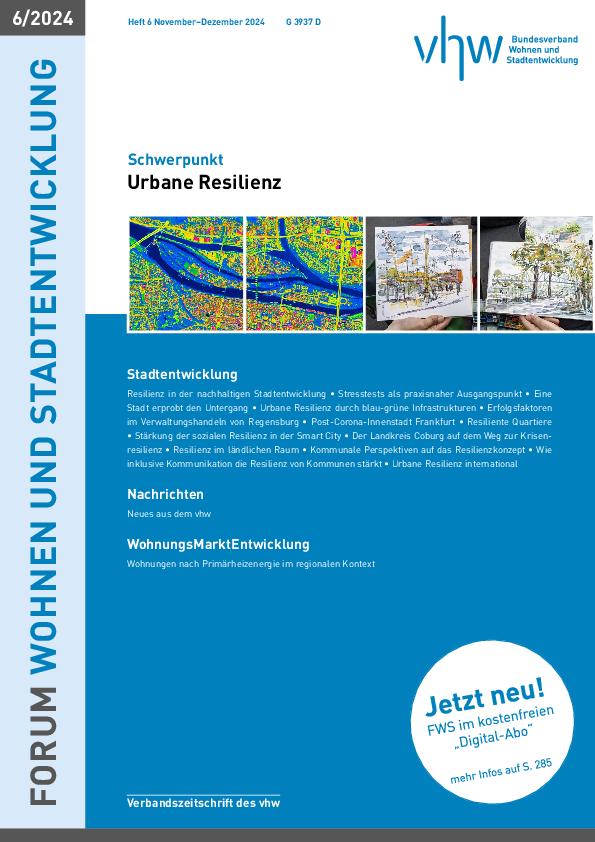
Erschienen in Heft 6/2024 Urbane Resilienz
Städte müssen sich weltweit an neue Gegebenheiten anpassen. Mobilitätswende, Klimakrise, soziale Ungleichheit, neue Nutzungsanforderungen und die fortschreitende Digitalisierung stellen neben den wirtschaftlichen Abhängigkeiten große Herausforderungen dar. Wie gestaltet man eine Stadt, die diese Herausforderungen meistert und in der sich alle wohlfühlen? Wie kann innerstädtischer Einzelhandel in Zeiten des Online-Shoppings funktionieren? Wie bleibt die Innenstadt für diverse Zielgruppen attraktiv? Diese Fragen beschäftigen die Politik in Brüssel, Berlin und Frankfurt. Die Stadt Frankfurt am Main schafft Strukturen, in denen sich Akteure aus Stadtgesellschaft, Initiativen, Vereinen, Verwaltung und Politik gemeinsam einbringen können, um Ziele und Visionen für die Frankfurter Innenstadt zu erarbeiten, Konzepte zu entwickeln und Maßnahmen umzusetzen. Grundlage für konkrete Maßnahmen des nachhaltigen Stadtumbaus sind die europäischen Richtlinien der „Neuen Leipzig Charta“, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Frankfurt 2030+, das Innenstadtkonzept sowie weitere sektorale Studien, Rahmen- und Masterpläne, deren Umsetzung in die Praxis gemeinsames, fachübergreifendes Handeln fordert. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht!
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2015 Die Innenstadt als Wohnstandort
Viele Städte und Gemeinden in NRW stehen vor den gleichen Herausforderungen und Problemen. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung zukunftsfähiger und attraktiver Innenstädte und Ortskerne in Nordrhein-Westfalen. So vielfältig, komplex und individuell hierbei die Aufgaben sind, so breit und unterschiedlich sind auch die Ansatzmöglichkeiten, Methoden, Instrumente und Programme, diesen zu begegnen. In vielen Städten und Gemeinden liegen spezifische und langjährige Erfahrungen im Umgang mit den aktuellen Herausforderungen der Innenstadtentwicklung vor. Auch wenn jeweils individuelle Lösungen erforderlich sind, ist ein Austausch über die Erfahrungen hilfreich.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2018 Kooperationen im ländlichen Raum
In den letzten Jahren stand der zunehmende Gegensatz zwischen dem Wachstum der Metropolen und dem Bevölkerungsrückgang in weiten Teilen des ländlichen Raums im Mittelpunkt der Diskurse zur demografischen und räumlichen Entwicklung. Eine solche Fokussierung auf zwei gegensätzliche Pole lässt aber außer Acht, dass die Situation in vielen Gemeinden vielschichtiger ist. Dies gilt insbesondere für das Umland und die Verflechtungsbereiche der großen Städte, in denen sich der Zuzug vor allem von jungen Familien und die Abwanderung beispielsweise von erwachsen gewordenen Kindern überlagern. Höchste Zeit also, über Planungsstrategien für den suburbanen Raum der großen Städte nachzudenken.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2005 Bürgerorientierte Kommunikation / Teilhabe an Stadtentwicklung und Wohnungspolitik
Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung sind derzeit gefragt wie nie. Zwar setzen seit eh und je alle Gesellschaften auf ein breit gefächertes Spektrum ehrenamtlicher Tätigkeiten einzelner Bürger als Ausdruck solidarischen Handelns in Kirche, Verbänden und Trägern der verschiedensten Fürsorgeaufgaben, in Verein und Familie. Soziale, gemeinschaftliche, sportliche und religiöse sowie kulturelle Aktivitäten wurden in keiner Epoche ausschließlich als Pflichtaufgaben des Staates allein verstanden. Trotz gesellschaftspolitischer Unterschiede galt das in BRD und DDR; beispielhaft verdeutlicht etwa in der Namensgebung "Arbeiterwohlfahrt" und "Volkssolidarität". Indes bleibt die aktuelle Hochkonjunktur der eingeforderten bürgerschaftlichen Aktivitäten in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft mit ihrer groß angelegten Kampagne ("Du bist Deutschland") bemerkenswert.In diesen Anmerkungen geht es sehr eingeschränkt um die Partizipation im urbanen Kontext, um die Einbindung betroffener Stadtbürger in die Sanierung und den Umbau ihrer städtischen Lebenswelten. Aber auch diese scheinbare Einengung des Themas erweist sich bei genauerem Hinsehen als komplex genug – spiegeln doch die derzeitigen Probleme der Stadtentwicklung auf lokaler Ebene den ökonomischen, sozialen und kulturellen Wandel der gesamten Gesellschaft wider, der seinerseits auf globale Hintergründe und Ursachen verweist.Als weitere pragmatische Begrenzung sind deshalb beobachtete Sachverhalte aus der eigenen alltäglichen Arbeit in der Stadterneuerung und dem Stadtumbau in Ostdeutschland die Grundlage der folgenden Überlegungen zur tatsächlichen und zur "gefühlten" Bürgerbeteiligung in diesen Bereichen.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2012 Stadtentwicklung und Sport
Hamburg verfügt über große attraktive Parks: Planten un Blomen, der Stadtpark, der Altonaer Volkspark und der Öjendorfer Park sind wichtige Orte der Naherholung im Hamburger Stadtraum. Mit der Internationalen Gartenschau Hamburg entsteht auf der Elbinsel Hamburgs ein neuer Park, der ab 2014 als Wilhelmsburger Inselpark allen Hamburgerinnen und Hamburgern zur Verfügung stehen wird. Im östlichen Teil des Parkgeländes entstehen dabei auf einer neun Hektar großen, ehemaligen Asphaltfläche vielfältige Freizeitsportangebote für Jung und Alt. Hauptziel war und ist es, Bewegung im Alltag zu ermöglichen: für alle, wohnortnah, fast durchgehend kostenfrei.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2023 Kommunale Religionspolitik
Dieser Beitrag spiegelt verschiedene Beobachtungen der sehr unterschiedlichen bezirklichen Praxis, auf Berliner Friedhöfen Begräbnismöglichkeiten nach islamischem Ritus einzurichten. Darin zeigt sich das Potenzial, räumlich die Vielfalt von Existenzweisen der Menschen in der Stadt anzuerkennen, zu gestalten und damit zur Transformation der Gesellschaft in ökologischer Verantwortung beizutragen. Die Bedeutung von Friedhöfen als Orten der Verbundenheit zwischen Tod und Leben, Kultur, Natur, Lebenswissen aus den Religionen, wird gerade neu erkennbar. Die Rede von „Integration“ richtet den Blick auf die Leistung der Menschen, die in Migration sind. Sich beheimaten zu können, setzt voraus, dass die Erfahrung des Einräumens von Lebensmöglichkeiten – auch für trauernde – Menschen gemacht werden kann. Exemplarisch scheint mit dem Thema der Friedhöfe die Gegenseitigkeit auf, in der Akteure der gesellschaftlichen und ökologischen Veränderungen zur Gestaltung von Frieden und Gerechtigkeit aufeinander angewiesen sind. Dabei zeigt sich auch eine neue Wahrnehmung des „Religiöse[n] außerhalb der Religion“ (Latour 2014, S. 415), in dem Menschlichkeit im Innehalten regeneriert werden kann.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2018 Meinungsbildung vor Ort – Chancen für Stadtentwicklung und lokale Demokratie
Wenn Menschen wissen möchten, was in ihrer Familie passiert, dann setzen sie sich mit ihr zusammen oder greifen zum Telefon. Wenn sie wissen möchten, wie es ihrer Nachbarin geht, dann klingeln sie dort. Wenn sie aber daran interessiert sind zu wissen, was sich in ihrem Stadtteil oder ihrer Stadt ereignet, dann reichen interpersonale Kommunikationsformen in der Regel nicht mehr aus: Sie greifen auf entsprechende mediale Kommunikationsangebote zurück. Im Alltag der Menschen spielte lokale Kommunikation schon immer eine zentrale Rolle. Sie ist gebunden an und strukturiert durch den Ort, der im Mittelpunkt des Austauschs oder des Interesses steht.
Beiträge
Erschienen in Heft 2/2014 Zuwanderung aus Südosteuropa – Herausforderung für eine kommunale Vielfaltspolitik
Als lebensweltlich konkreter Ausgangspunkt für meinen historisch angereicherten migrationswissenschaftlichen Blick auf das Thema dienen meine persönlichen Erfahrungen als Duisburger Bürger. Ich beginne mit meinen Beobachtungen und Gesprächen, die ich als Bewohner des Stadtteils Duisburg-Neumühl mit leider erfolgreich von den Medien und der Rechtspopulistischen Partei Pro-NRW "angefixten" Anwohnern geführt habe: Am 9. November 2013, dem Gedenktag zur Reichspogromnacht, brüllten in Duisburg-Neumühl, einer SPD-Hochburg, ca. 30 aus Köln zugereiste deutsche Bürger der zu den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen kandidierenden Pro NRW-Partei zum zweiten Male vor dem leerstehenden Gebäude des ehemaligen St. Barbara-Hospitals "Kein Asyl in Neumühl". Im August war das Gerücht in der Presse verbreitet worden, dort würden 500 Roma untergebracht.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2019 Child in the City
Im Rahmen des Verbandstages 2018 in Berlin berief die Mitgliederversammlung am 15. November 2018 die vhw-Gremien neu. Der Verbandsrat besteht aus 14 Mitgliedern, 4 Mitglieder sind ausgeschieden, 4 neue Vertreter wurden in den Verbandsrat gewählt. Dem Gremium mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern obliegen unter anderem die Beratung und Aufsicht des Vorstandes. Im Kuratorium des vhw sind aktuell 51 Personen, neu wurden 10 Mitglieder gewählt, 6 Mitglieder sind ausgeschieden. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 5 Personen, 3 Mitgliedern und 2 Vertretern. Gemäß der Satzung des vhw wurden Verbandsrat, Kuratorium und Rechnungsprüfungsausschuss für die Dauer von drei Jahren gewählt.
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Im Rahmen des Verbandstages 2015 in Berlin berief die Mitgliederversammlung am 12. November 2015 die vhw-Gremien neu. Der Verbandsrat besteht aus vierzehn Mitgliedern, drei Mitglieder sind ausgeschieden, frei neue Vertreter wurden in den Verbandsrat gewählt. Dem Gremium mit seinen ehrenamtlichen Mitgliedern obliegen u. a. die Beratung und Aufsicht des Vorstandes. Im Kuratorium des vhw sind aktuell 48 Personen, neu wurden neunzehn Mitglieder gewählt, sechzehn Mitglieder sind ausgeschieden. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus fünf Personen, zwei sind ausgeschieden, dafür wurden zwei neue Mitglieder in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt. Darüber hinaus hat die Mitgliederversammlung Frau Prof. Christiane Thalgott zum Ehrenmitglied des Verbandes berufen. Frau Thalgott war von 2003 bis 2015 Mitglied des vhw-Vorstandes bzw. des Verbandsrates. Gemäß der Satzung des vhw wurden Verbandsrat, Kuratorium und Rechnungsprüfungsausschuss für die Dauer von drei Jahren gewählt.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2024 Verpflichtet Eigentum? Planung zwischen Eigentümer- und Gemeinwohlinteressen bei der Innenentwicklung von Städten

Erschienen in Heft 3/2024 Kooperative Stadtentwicklung

Erschienen in Heft 2/2016 Renaissance der kommunalen Wohnungswirtschaft
Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung stellt sowohl die Kommunen als auch die Wohnungswirtschaft vor neue Herausforderungen. Dies gilt nicht nur aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen sowie einer daraus resultierenden Zuwanderung und Integration, der sich die Kommunen insbesondere seit dem Sommer 2015 stellen müssen. Vielmehr stellt sich schon seit der Mitte des letzten Jahrzehnts heraus, dass die demografische Entwicklung sowie veränderte Familien- und Arbeitsstrukturen auch neue Anforderungen an den Wohnungsmarkt und den Wohnungsbau stellen. Vor allem in den großen Städten sind neue Wohnungsfragen herangereift. Dabei wird die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum immer stärker als Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklung begriffen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2010 Integration und Stadtentwicklung
Die aufgeregte Integrationsdebatte der letzten fünf Jahrzehnte hat den Umgang mit Migranten in der Bundesrepublik tief greifend geprägt und ein Rezeptwissen hervorgebracht, das auch heute noch in allen gesellschaftlichen Bereichen als Maßstab der Orientierung gilt. Pauschal ist von Anpassungsproblemen der Migranten, dem Rückzug in ethnische Nischen und von Parallelgesellschaften die Rede. Vor allem im politischen Kontext ist der Integrationsbegriff zu einer Schlüsselkategorie geworden. Immer mehr Städte suchen in letzter Zeit händeringend nach Integrationskonzepten.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2021 Wohnen in Suburbia und darüber hinaus
Seit einem Jahr ist viel über die Freuden des Landlebens zu lesen beziehungsweise über die Städterinnen und Städter, die selbiges für sich entdeckt hätten. In Umbruchzeiten haben einfache Aussagen Hochkonjunktur, und so scheint es die Innovation des Homeoffice zu sein, die von den Zwängen des Stadtlebens befreit und nicht mehr die Wohnkosten, die einen Verbleib in der Stadt erschweren … In den wachsenden Agglomerationsräumen vergrößert sich seit über zehn Jahren der Nachfrageüberhang an den Wohnungsmärkten. Infolge dessen kletterten die lokalen Miet- und Kaufpreise auf ein Allzeithoch, und die Wohnungsfrage besetzte vordere Plätze auf den politischen Prioritätenlisten von Bund, Ländern und Kommunen. Aus der Problemfeststellung „Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit“ (Seehofer 2020) wurde zumeist „bauen, bauen, bauen“ als Hauptaufgabe abgeleitet. Neben ambitionierten Baufertigstellungszielen in den einzelnen Städten wurden aber in den letzten Jahren auch die Stadtregionen als strategischer Handlungsraum sukzessive (wieder-)entdeckt. Damit war die Stadtentwicklungsplanung allerdings kein Taktgeber – denn für wohnungssuchende Haushalte waren Wohnalternativen im Umland immer existent. Die Frage ist, wie diese perspektivisch aussehen und gestaltet werden können.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2012 Nachhaltigkeit und Wohnen

Erschienen in Heft 6/2009 Nachhaltigkeit im Wohnungs- und Städtebau
Ungeachtet des herben Rückschlags für eine wirksame globale Klimaschutzpolitik auf der Kopenhagener Weltklimakonferenz im Dezember 2009 bleiben Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf der nationalen wie der lokalen Ebene an der Spitze der politischen Zukunftsagenda. Im Fokus der vhw-Strategie der kommenden Jahre steht dabei die kommunale Ebene. Eine vom Bürger gleichberechtigt mitentwickelte und mitgetragene Stadtgesellschaft, die vom engen Zusammenwirken der Akteure geprägt ist und auf die Mehrung des Gemeinwohls zielt, muss den Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen und den übrigen Eckpfeilern der Stadtentwicklung auf eine langfristig tragfähige, generationenübergreifende, dh. nachhaltige Basis stellen.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2016 Kultur und Stadtentwicklung
Will man über die nachhaltigen Effekte der Kulturhauptstadt Europas „RUHR.2010 – Essen für das Ruhrgebiet“ nachdenken, führt kein Weg an der Genese dieses einzigartigen kulturellen Festjahres in 53 Städten vorbei. Das Ruhrgebiet als altindustrielle Region, die massiv vom Strukturwandel und den Auswirkungen durch den Wegfall der Stahl- und Kohleindustrie gebeutelt war und ist, bekam durch die IBA Emscher Park unter der Leitung von Prof. Dr. Karl Ganser über einen Zeitraum von zehn Jahren (1989 bis 1999) eine neue Perspektive und vor allem eine neue inhaltliche und räumliche Nutzungsstruktur. Industriehallen wurden zu Orten – Kathedralen – der Kunst und Kultur, Halden wurden zu Landmarks und Ausflugszielen, Industriebrachen zu renaturierenden Parks etc. Vor allem das heutige Welterbe Zollverein erhielt mit dem Masterplan von Rem Koolhaas als Ort für Design, regionale Erinnerungskultur sowie Performing Arts eine zentrale Bedeutung bei den Transformationsprozessen der Region.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2016 Stadtentwicklung und Sport
Die Revitalisierung einer wichtigen Ladenstraße im Kölner Stadtteil Porz war in einer Sackgasse gelandet. Das dominierende Hertie-Kaufhaus steht seit 2009 leer und es fand sich kein Nachnutzer. Benachbarte Passagen und Geschäfte verwaisten. In dieser Situation erwarb vor zwei Jahren die Stadt das Gebäude, um das Heft des Handelns in die Hand zu bekommen. In einem gemeinsamen Kraftakt bemühen sich seitdem Stadt, Bürger und die Stadtentwicklungsgesellschaft moderne stadt GmbH das Blatt zu wenden. Dabei soll bei der Stadterneuerung und Revitalisierung des zentralen Friedrich-Ebert-Platzes nicht die günstigste, sondern die zukunftsträchtigste und verträglichste Variante realisiert werden. Hierfür muss das Warenhaus-Gebäude abgerissen werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2023 Bildung in der Stadtentwicklung
Zum Jahresbeginn 2023 gab es in Berlin Übergriffe von jungen Erwachsenen auf Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, die ein erregtes politisches und mediales Echo auslösten. In Stellungnahmen, die im Brustton sozialwissenschaftlicher Erklärung vorgebracht wurden, hieß es unter anderem: Viele der jungen Straftäter würden in Großwohnsiedlungen in den Randbezirken leben. Dort könne aufgrund der sozialen Zusammensetzung der Bewohner Integration nicht gelingen. Auf dem Fuße folgten aus Verbänden und Parteien Forderungen nach einer besseren sozialen Mischung. Das Kompetenzzentrum Großsiedlungen, eine unternehmensnahe Gründung der landeseigenen Wohnungsunternehmen, trat für eine Herabsetzung der Wiedervermietungsquote an die untersten Einkommensgruppen ein, um eine bessere soziale Mischung der Bevölkerung sicherzustellen. Die Ereignisse rund um den Jahreswechsel warfen ihren Schatten bis hinein in die schwarz-rote Koalitionsvereinbarung. Das Leitbild der sozialen Mischung wird hier aus der tagespolitischen Auseinandersetzung herausgenommen und im sozialwissenschaftlichen Kontext überprüft. Gefragt wird, ob es sich um ein taugliches Leitbild der städtischen Planung handelt und ob es funktionieren kann. Die Antwort, das sei vorab verraten, lautet: "Nein".
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2011 Neue Dialogkultur: Wir sprechen uns im Web 2.0
Durch die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien sind in Politik und Verwaltung erhebliche Veränderungsdynamiken in Kraft gesetzt worden. Diese stellen für die Kommunen einerseits Herausforderung, andererseits aber auch ein enormes Potenzial dar. Auf dem Weg zu einer aktiven Bürgergesellschaft werden Social-Media-Prozesse immer bedeutender. Eine neue digitale Partizipationskultur etabliert sich, in der sich nicht nur die Reichweite gegenüber der traditionellen Informationsbereitstellung vergrößert, sondern sich auch Räume für ganz neue Formen der Bürgerbeteiligung herausentwickeln. Ein Engagement im Web 2.0 gehört aus diesem Grund auf die Agenda der Städte im 21. Jahrhundert.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2022 Zukunft Landwirtschaft: zwischen konkurrierender Landnutzung und Klimawandel
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat aktuell Diskussionen ausgelöst über die Freigabe von in der Agrarpolitik so genannten ökologischen Vorrangflächen als Beitrag zur Sicherung der Nahrungsmittelproduktion und über den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien zulasten des Naturschutzes. Hier kommt zum Ausdruck, was sich als ein allgemeiner Trend betrachten lässt: das Ansteigen von Nutzungsdruck auf Landflächen. Diese werden eben nicht nur zur Produktion von Nahrungsmitteln und Energie in Anspruch genommen, sondern auch als Siedlungs- und Verkehrsflächen, als Standorte für Betriebe und als Raum, der Erholung ermöglicht und vielfältigen Freizeitaktivitäten dient. Und die Regeneration der Natur sollen sie auch noch ermöglichen. Damit eine wachsende Zahl von Ansprüchen und Zwecken von einer begrenzten Landfläche erfüllt werden kann, wird Landnutzung heute vielfach multifunktional gedacht. Das heißt, mit einer Raumeinheit Land wird nicht nur ein Nutzungszweck verfolgt, sondern mehrere. Dies kann in Konflikt stehen zu etablierten Gewohnheiten und gängigen Wirtschaftlichkeitserwägungen. Damit Multifunktionalität zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt, sind komplexe Sachverhalte zu berücksichtigen. Unser Beitrag verdeutlicht die verschiedenen Dimensionen von Multifunktionalität – vom Grundsätzlichen bis zum Konkret-Praktischen – und zeigt auf, welche Orientierungsmöglichkeiten das Konzept eröffnet.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2014 Wohnen in der Stadt – Wohnungspolitik vor neuen Herausforderungen
In zentraler Lage von Heidelberg entsteht derzeit mit der Bahnstadt ein neuer Stadtteil mit einer Mischung aus Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe, Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie der notwendigen Infrastruktur wie Einkaufen, Schulen und vielfältigen Kinderbetreuungseinrichtungen – komplett in Passivhaus-Bauweise. Auf dem Areal sollen künftig 12.000 Menschen leben und arbeiten. Die Nachfrage ist so groß, dass die Bebauung deutlich schneller vorankommt als geplant. Damit ist die Bahnstadt heute schon ein Erfolgsmodell, das beispielhaft zeigt, wie sich Städtebau und Klimaschutz vereinen lassen. Das entwickelte Angebot kommt so gut an, dass die Realisierung um zwei Jahre vorgezogen wurde.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2021 Verkehrswende: Chancen und Hemmnisse
Eine Mobilitäts- und Verkehrswende wird vermehrt in fachpolitischen Programmen postuliert – zumeist ohne Begriffsklärungen, aber überwiegend mit positiven Konnotationen als nachhaltige Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung. Derzeit dominieren in diesem Zusammenhang vor allem Ziele des Klimaschutzes und der Reduktion von CO2-Emissionen – allerdings weitgehend ohne die erforderlichen gesamthaften Wirkungsanalysen und Wirkungsabwägungen. So unterbleiben zumeist Gesamtbilanzierungen der Herstellungs-, Betriebs- und Verwertungsprozesse der Elektromotoren und Batterien. Es fehlen Betrachtungen von Gewinnung, Transport und Verwertung von Rohstoffen (z. B. Lithium aus Chile, Bolivien und Peru) oder der Nutzung von Wasserressourcen. Dies gilt auch für die Bereitstellung von öffentlichen ("Schnell-")Ladestationen und deren Einbindung in Mittelspannungsnetze der Städte. Auch der Ausbau regenerativer Energieerzeugung aus Windkraft und Sonnenenergie sowie der Energieumwandlung, -speicherung und -verteilung (Fernnetze, Vernetzung, dezentrale Netze und Speicher) muss zwingend in die Betrachtung aufgenommen werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 3/2011 Stadtentwicklung in Klein- und Mittelstädten
Eine hohe Lebensqualität, ein historisches Stadtgefüge, ein vielseitiges Bildungs- und Freizeitangebot – Werte, die nicht jeder gleich mit Verden verbindet, mit dieser kleinen, norddeutschen Stadt an der Aller. Und doch hat Verden all das – und noch viel mehr. Die Verdener sind stolz auf ihre Stadt. Man wohnt oder arbeitet nicht nur, man lebt hier. Und das mittendrin im Dreieck von Bremen, Hamburg und Hannover. Um dieses Potenzial – Reiterstadt, Domstadt, Stadt am Fluss – zu sichern und zu stärken, geht Verden den Weg der integrierten Stadtentwicklung. Dabei ist es in Verden längst zur Selbstverständlichkeit geworden, dass Bürger bei der Planung und Entwicklung der Stadt mitreden und mitwirken – ein Erfahrungsbericht.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2019 Stadtentwicklung und Klimawandel
Möchte man erfassen, welche Haltungen die deutsche Bevölkerung zu Klimawandel und Klimaschutz einnimmt, sind diese nicht isoliert zu betrachten, sondern als integrales Element im Gesamtkontext der Umwelt- und Naturwahrnehmung zu verstehen. Innerhalb dieses Rahmens ist Klimawandel dabei aus Perspektive der Bevölkerung insbesondere an die Themenfelder Ressourcenverbrauch, Energie, Mobilität und biologische Vielfalt gekoppelt. Damit schlägt das Thema Klimawandel auch eine Brücke zu aktuellen Fragen der Stadtentwicklung, da das Verhältnis von Stadt und Natur aktuell einem grundlegenden Wandel unterworfen ist.
Beiträge
Erschienen in

Erschienen in Heft 5/2011 Mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog
Würfel – überall Würfel! Wer die Berliner Kalkscheune zum 2. Kongress Städtenetzwerk, der gleichzeitig der vhw-Verbandstag 2011 war, betrat, kam um die Blickfänger der Veranstaltung nicht herum. In allen Räumen verbreiteten sie das Motto des Städtenetzwerks "mehr wissen – mehr wagen – mehr Dialog!". Auch aus den Veranstaltungsunterlagen sprangen den Teilnehmern Springwürfel entgegen, die auf dem heimischen Schreibtisch oder im Büro, wenn schon nicht als Briefbeschwerer, so doch als Souvenir an eine denkwürdige Veranstaltung dienen können. Etwa 250 Besucher sorgten für ein volles Haus, eine Mischung aus vhw-Verbandtags-Community, "alten Bekannten" des ersten Kongresses zum Städtenetzwerk und zahlreichen neuen Gesichtern, die sich zum Stand der Dinge in der Dialogphase des Städtenetzwerkes erkundigen und natürlich mitdiskutieren wollten.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2019 Vertrauen in der Stadtgesellschaft
Demokratische Gesellschaften und ihre Institutionen sind auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Parlamente und Regierungen werden durch Wahlen legitimiert. Wählerinnen und Wähler erwarten von den Gewählten, dass sie sich im Sinne des Gemeinwohls engagieren, dabei aber auch die Interessen ihrer Wähler nicht vernachlässigen. Sie schenken ihnen das Vertrauen. Gleichzeitig besteht in repräsentativen Demokratien immer die Gefahr, dass politische Vertreter die Anliegen von Bürgern zu wenig beachten, nicht aufnehmen oder die von ihnen getroffenen Entscheide zu wenig erklären. Bürger wie Politiker sind dabei auf die Vermittlungsleistungen vor allem der Medien angewiesen. Durch Vermittlungsdefizite der Medien kann Misstrauen gegenüber der Politik entstehen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2009 Stadtgesellschaft neu vermessen! – Wie muss die soziale Stadt gestaltet werden?

Erschienen in Heft 1/2024 Zukunft der Innenstädte in Deutschland
Große Modeketten prägten bis vor wenigen Jahren die Fußgängerzonen. Das hat sich geändert und schafft Raum für Konzepte anderer Branchen. Warum unter anderem Drogeriemärkte und Gastronomiebetriebe in Toplagen gehen und welche weiteren Branchen flächenhungrig sind, darum geht es im vorliegenden Beitrag.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2008 Migranten-Milieus in Deutschland
"Bürgerengagement" ist ein Stichwort, das Vieles bezeichnen kann. Daher ist, wenn Engagement gefördert und Engagementpolitik betrieben werden sollen, Klärung vonnöten: Welches und wessen Engagement ist gemeint? Wer engagiert sich? Für was? Wo findet sich Engagement in der Stadt und wo nicht? Und natürlich: Soll und kann dieses Engagement gefördert werden - und wenn ja: wie?
Beiträge
Erschienen in Heft 1/2016 E-Commerce und Stadtentwicklung
Verbunden mit dem gesellschaftlichen Wandel und technologischen Innovationen hat es fortlaufend strukturelle Veränderungen im Einzelhandel gegeben, die stets auch Auswirkungen auf die Stadtentwicklung hatten. Mit dem Onlinehandel findet nun ein Wechsel der Vertriebsform vom stationären Handel zum Distanzhandel statt. Angesichts des dynamischen Umsatzwachstums im Onlinehandel stellt sich neben der Frage nach den Konsequenzen dieser Entwicklung für die Stadtentwicklung auch die Frage, inwiefern die Akteure vor Ort auf diese Entwicklungen reagieren können. Lokale Online-Marktplätze bilden einen möglichen Ansatzpunkt zur Vernetzung von stationärem Geschäft und Vertrieb über das Internet. Der Beitrag gibt einen ersten Überblick über Ziel und Gegenstand sowie Chancen und Grenzen derartiger Plattformen.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2023 Bildung in der Stadtentwicklung
Ein Quadratkilometer Bildung setzt auf kleinräumige, lokale Bildungsnetzwerke, um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in Sozialräumen zu erhöhen, in denen überproportional viele Familien von Armut betroffen sind. Unterstützt durch eine sogenannte Pädagogische Werkstatt setzen Akteurinnen und Akteure der formalen, nonformalen und informellen Bildung Schwerpunktthemen und entwickeln bedarfsgerechte Praxislösungen – gemeinsam nach dem Bottom-up-Prinzip. Schulen und Kindertagesstätten öffnen sich in den umliegenden Sozialraum, und eine wachsende Verantwortungsgemeinschaft verschiedener Akteure realisiert innovative, vernetzende Praxisansätze, die einen wichtigen Beitrag für die Quartiersentwicklung leisten.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2021 Wohnen in Suburbia und darüber hinaus
Mit der Beauftragung der Studie „Lokale Demokratie in Klein- und Mittelstädten unter den Bedingungen von Peripherisierung“ (vgl. Görmar et al. 2020) wurde in der wissenschaftlichen Arbeit des vhw-Forschungsbereichs vor gut drei Jahren ein Siedlungstyp näher in den Fokus gerückt, der in der Vergangenheit vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit in der bundesweiten Raumforschung gefunden hat: die Kleinstadt. Durch eine Mitwirkung im ExWoSt-Forschungsfeld Pilotphase Kleinstadtakademie des BMI/BBSR, im Rahmen eines Modellvorhabens, können die Arbeiten zur lokalen Demokratie in Kleinstädten anwendungsorientiert fortgeführt werden. Der Artikel gibt einen allgemeineren Überblick über wichtige Eckpunkte und Einflussfaktoren auf die lokale Demokratie in Kleinstädten und legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Potenziale und Ausgangsbedingungen für bürgerschaftliche Teilhabe.
Beiträge
Erschienen in Heft 5/2023 Im Osten viel Neues: genutzte Potenziale, engagierte Akteure, erfolgreiche Stadtentwicklung
In diesem Beitrag wird aus einem Projekt berichtet, das sich mit der Verbesserung von Bürgerbeteiligung bei kommunalpolitischen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen in Kleinstädten befasst hat. Im Projekt, dem Modellvorhaben "Lokale Demokratie gestalten – Beteiligungspraxis zur Stadtentwicklung in Kleinstädten", waren fünf Städte beteiligt: Eilenburg und Wurzen in Sachsen, die Hansestadt Osterburg (Altmark) in Sachsen-Anhalt, Großräschen in Brandenburg und Bad Berleburg in Nordrhein-Westfahlen. Der vhw hat die Kommunen wissenschaftlich begleitet. Im Modellvorhaben, das im Rahmen der vom BBSR und BMWSB geförderten Pilotphase Kleinstadtakademie stattgefunden hat, wurden zunächst die bisherigen Erfahrungen der Kommunen mit Bürgerbeteiligung betrachtet, darüber hinaus konkrete (neue) Beteiligungsformate und -ansätze erprobt sowie die dabei vorzufindenden spezifisch kleinstädtischen Rahmenbedingungen der Kommunen in den Blick genommen. Inhaltliche Schwerpunkte lagen zudem im Themenfeld der Jugendbeteiligung und der Stärkung ehrenamtlicher Vertretungsstrukturen innerhalb dörflicher Ortsteile.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2017 Die Digitalisierung des Städtischen
Ein bisher beim Thema digitale Kommunen wenig beachteter Aspekt, nämlich die Logistik, gerät bei der Entwicklung der Städte immer mehr in das Scheinwerferlicht. Logistik und Mobilität sind die ersten Vorboten einer umfassenden und grundlegenden Transformation der Kommunen. Eine überragende Bedeutung bekommen Daten, doch viele Fragen sind noch offen. Zukunft wird lokal gemacht, denn die Kommunen und Regionen sind es, die den Lebensraum der Menschen und den Standort der Unternehmen prägen und gestalten. Gesellschaftliche Herausforderungen wie Klima, Energie, Bildung, Gesundheit, Mobilität und Sicherheit zeigen sich vor Ort. Hier manifestieren sich die Probleme, hier müssen sie auch gelöst werden.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2015 Quartiersmanagement
Das große Versprechen der Stadt hat, grob gesehen, zwei Seiten – eine ideelle und eine materielle. Beide hängen wie bei einer Medaille eng zusammen; beide müssen aber immer wieder getrennt betrachtet und gewichtet werden. In den entwickelten, westlich orientierten Gesellschaften geht es vorrangig um Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, Lebensstandard und leistungsfähige Infrastruktur. Es zählt, was man gewinnen, erleben und besitzen kann. Städte, die über Resilienz und Zukunft nachdenken, wollen als Erstes – einschließlich ökologischer Rücksichten – ihre materiellen Grundlagen absichern. Für die meisten sind also attraktive Lebensräume und florierende Wirtschaftssysteme fest miteinander verbunden. Persönliches Vorankommen und der eigene Lebensstandard gehen vor – und sie prägen das soziale Klima.
Beiträge
Erschienen in Heft 4/2010 Bürgerorientierung in der integrierten Stadtentwicklung
Mit Beginn des Jahres 2007 hatte Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft inne. Damit verbunden war die Chance, auf der europäischen und internationalen Bühne Themen zu setzen und neue fachpolitische Diskussionen auszulösen. Es ging dem deutschen Ratsvorsitz u.a. darum, europäische Entscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen. Für solche bevölkerungsnahen Politikansätze bietet sich die Stadt- und Raumentwicklung geradezu an. Denn die Bevölkerung erlebt die Konsequenzen Brüsseler Entscheidungen letztendlich in ihrer konkreten Lebensumwelt – sei es in der Nachbarschaft, in der Gesamtstadt oder in der Region.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2008 Migranten-Milieus in Deutschland
Die Studie Migranten-Milieus zu den Lebenswelten der in Deutschland wohnenden Migranten ist erwachsen geworden. Und das zu Recht, denn mit einem Bevölkerungsanteil von über 18 Prozent (in manchen Städten sogar von über 40 Prozent) ist das Verständnis der Handlungslogiken dieser Personengruppe für den Bereich Wohnen und Stadtentwicklung mit Blick auf ihre Wohnvorstellungen und Engagementpotenziale von zentraler Bedeutung. Was 2007 noch als qualitative Grundlagenstudie vorlag, wurde nun im Sommer 2008 durch eine Befragung von über 2.000 Migranten in belastbare Zahlen übersetzt.
Beiträge
Erschienen in Heft 6/2008 Migranten-Milieus in Deutschland
Der Anteil junger Menschen mit einer schlechten Ausbildung ist zu groß. Viele Jugendliche haben Lern- und Bildungsprobleme sowie Sprachdefizite. Eine hohe Schulabbrecherquote und zunehmende Perspektivlosigkeit sind die Folge. Dies betrifft Jugendliche sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund. Während es zum Werteverhalten von "deutschen" Jugendlichen zahlreiche Untersuchungen gibt, fehlen größtenteils Informationen über die Werthaltungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie die Wertevermittlung in diesen Gruppen.
Beiträge