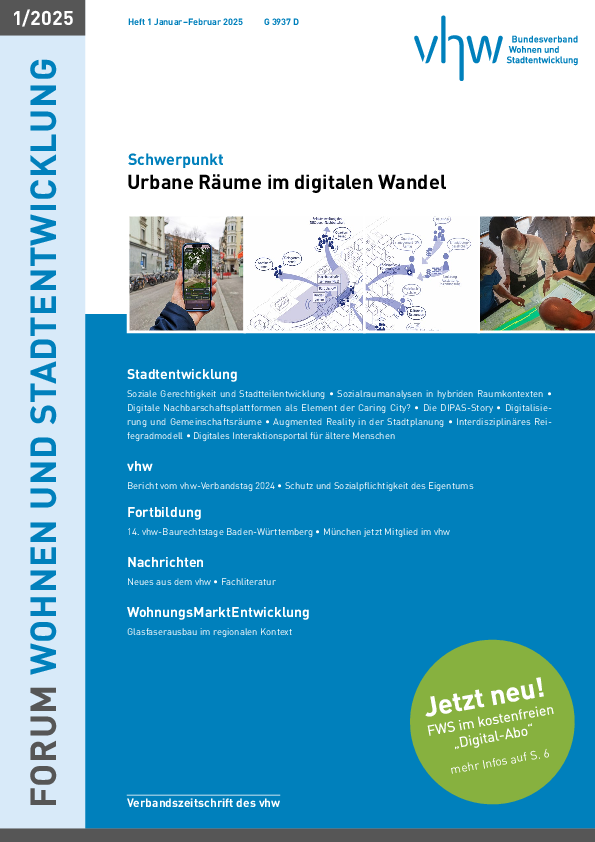
Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Mit abnehmender Mobilität steigen die Herausforderungen im Alltag älterer Menschen, beispielsweise beim Einkaufen, bei Bankgeschäften oder der Suche nach medizinischer Versorgung. Digitale Lösungen und soziale Netzwerke können helfen, diese Barrieren zu überwinden und die soziale Teilhabe zu fördern. Doch oft fehlen Senioren die nötigen Kompetenzen, um diese Technologien zu nutzen. Hier setzt das Projekt Seniorennetz Berlin an, mit dem Ziel, ältere Menschen im Umgang mit digitalen Medien und Informationen zu unterstützen und ihnen so mehr Selbstständigkeit und soziale Integration zu ermöglichen. Ursprünglich im Märkischen Viertel gestartet, hat es sich zu einem berlinweiten Vorzeigeprojekt entwickelt und zeigt, wie die Beteiligung von Senioren und die Kooperation verschiedener Akteure erfolgreich sein kann.
Beiträge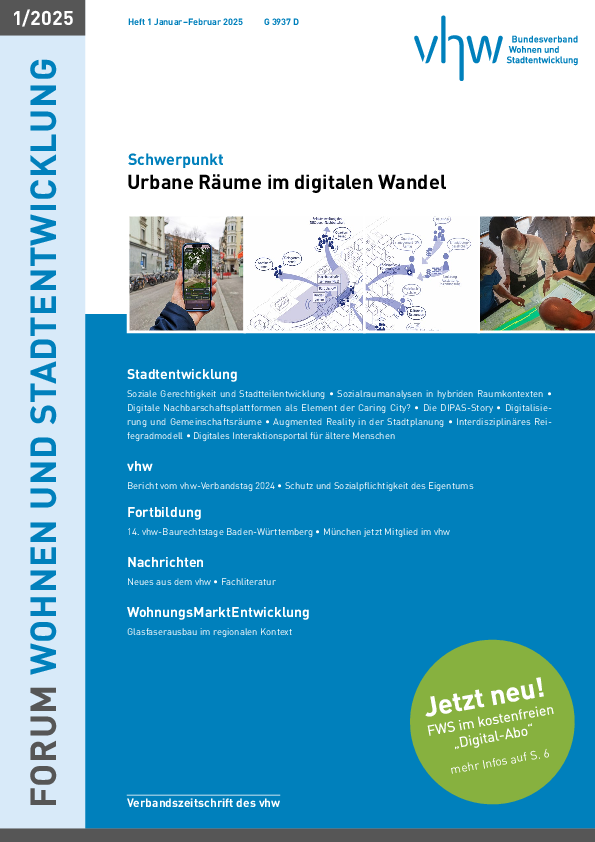
Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Multi-Generation Smart Community“ (mGeSCo) entwickelt ein Reifegradmodell zur nachhaltigen Begleitung digitaler Transformationsprozesse in urbanen Wohnquartieren. Im Living Lab Jena-Lobeda untersucht das Projekt, wie technische und soziale Dimensionen für eine erfolgreiche Smart-City-Integration kombiniert werden können. Das Modell erweitert etablierte Reifegradmodelle, indem es die Dimensionen Digitalkompetenz, Technologieakzeptanz und Deutungsmuster einbezieht, um eine umfassendere Bewertung und Förderung der digitalen Transformation zu gewährleisten. Die partizipative Einbindung der Bewohnenden durch Koproduktion und Kokreation zeigt, dass diese Methoden nicht nur die Identifikation mit dem Quartier stärken, sondern auch die Nutzung und Akzeptanz der eingesetzten Technologien fördern. Neben technischer Ausstattung wird hierdurch besonders die soziale Integration und das Gemeinschaftsgefühl im Quartier betont. Das Projekt leistet so einen Beitrag zur Diskussion über Smart Cities, indem es einen Ansatz verfolgt, der über technologische Lösungen hinaus auch auf soziale Inklusion und gemeinschaftliche Verantwortung setzt.
Beiträge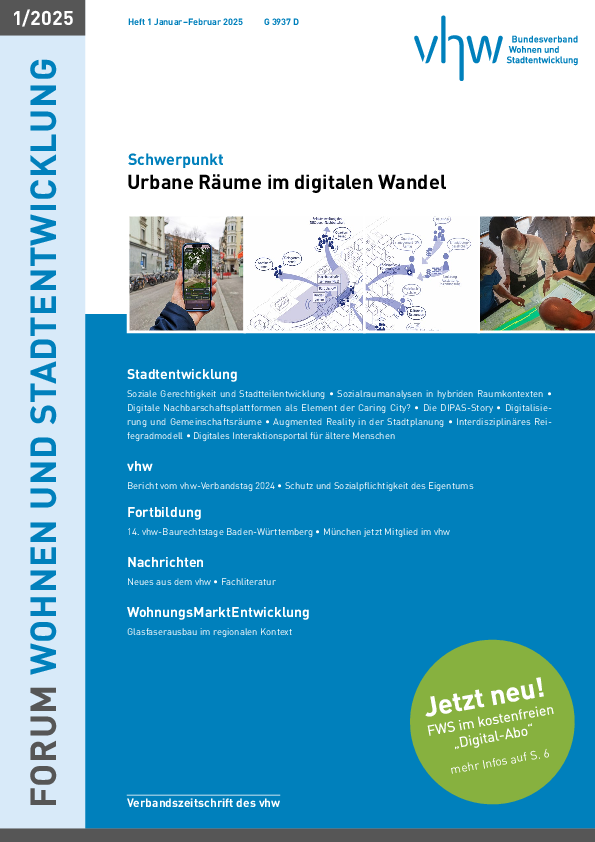
Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Die Beteiligung der Bevölkerung an städtischen Planungsprozessen wird durch kommunikative Hürden und begrenzte Reichweite erschwert. Dieser Beitrag zeigt auf, wie Augmented Reality (AR) diese Barrieren überwinden kann, indem Planungsprozesse anschaulich, interaktiv und in hybriden Räumen vermittelt werden. Dieser Beitrag präsentiert praxisorientierte Ansätze der Hochschule Luzern, die im Rahmen des Innosuisse-Projekts „Augmented Planning“ entwickelt wurden. Anhand von drei Fallbeispielen wird gezeigt, wie AR kooperative und inklusive Planungsprozesse fördern kann. Dabei werden sowohl die Potenziale als auch die Herausforderungen beleuchtet, die mit der Integration von AR in die Stadtplanung verbunden sind.
Beiträge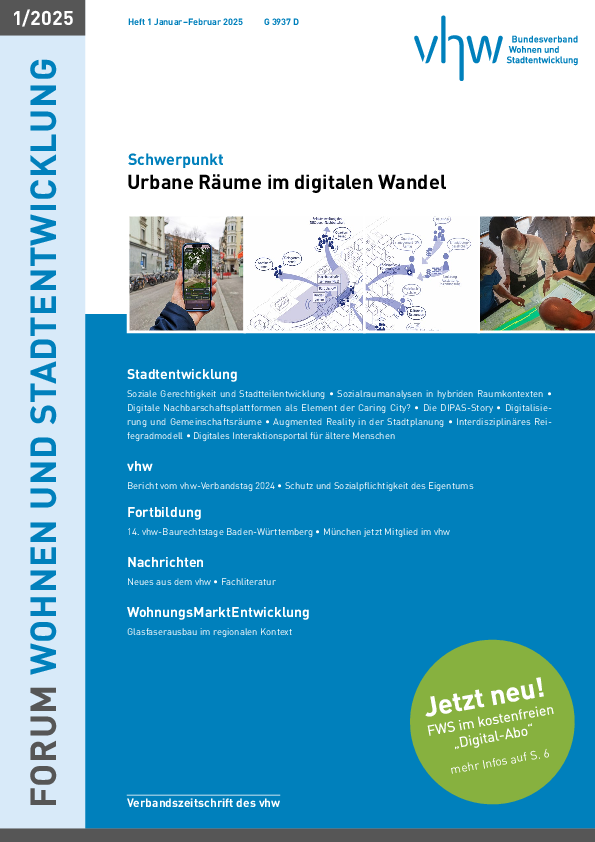
Erschienen in Heft 1/2025 Urbane Räume im digitalen Wandel
Seit etwa acht Jahren nutzt Hamburg intensiv digitale Bürgerbeteiligung, vor allem mit dem Digitalen Partizipationssystem (DIPAS). Im Folgenden soll kurz umrissen werden, wie diese Entwicklung zustande kam, wie digitale Beteiligung in Hamburg heute funktioniert, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und schließlich, an welchem Punkt wir heute stehen und wie es mit digitaler und analoger Beteiligung weitergehen soll.
Beiträge
Erschienen in

Erschienen in

Erschienen in
Ein Rückblick und Gedanken zur Verbesserung
Beiträge
Erschienen in

Erschienen in

Erschienen in
Zwischen den Akteuren am Immobilienmarkt in Ost und West hat sich eine Diskussion um die Übertragbarkeit des Stadtumbaukonzepts von Ost- auf Westdeutschland entsponnen. Diese Diskussion hat teilweise die Züge eines Verteilungskampfs um knapper gewordene Subventionsmittel angenommen. Der Artikel will diese Diskussion versachlichen. Anhand der unterschiedlichen Entwicklungsszenarien in Ost- und Westdeutschland wird überprüft, was Stadtumbau ausmacht und in welcher Form Stadtumbau eine Strategie für die anstehenden stadtstrukturellen Anpassungsprozesse in Deutschland sein kann.
Beiträge
Erschienen in

Erschienen in
Der Prototyp des Städters ist der Fremde. Städte sind seit jeher die Schmelztiegel der Gesellschaft gewesen, die kommunale Ebene ist aber auch der Ort, an dem Probleme bei misslingender Integration von Zuwanderern kulminieren. Was Kommunen und Wohnungsunternehmen leisten können, um zur sozialen und räumlichen Integration von Migranten beizutragen, untersucht das Projekt "Zuwanderer in der Stadt", das die Darmstädter Schader-Stiftung, der Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen (GdW),der Deutsche Städtetag (DST),das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) und das Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (InWIS) seit Januar 2004 in einem Verbund durchführen.
Beiträge
Erschienen in
Seit den 1970er Jahren sind die Städte in Westdeutschland einem tief greifenden ökonomischen Strukturwandel unterworfen, mit dem ein drastischer Abbau von Arbeitsplätzen im produzierenden Gewerbe verbunden ist. Als Folge dieses Wandels hat sich insbesondere in den altindustriellen Städten eine ausgeprägte strukturelle Arbeitslosigkeit und damit verbunden, eine fortschreitende Einkommensarmut herausgebildet. Neben dem ökonomischen Wandel findet in fast allen Städten aufgrund sinkender Geburtenzahlen und zunehmender Wanderungsverluste ein starker Bevölkerungsrückgang statt. Hierdurch werden Prozesse der räumlichen Polarisierung zwischen Arm und Reich zusätzlich verstärkt. Der Beitrag beschreibt den Zusammenhang zwischen Bevölkerungsrückgang und sozialer Segregation, fragt nach deren sozialen Folgen und umreißt die Reichweite der Interventionen im Rahmen von Stadtteilentwicklungsprogrammen.
Beiträge
Erschienen in
Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland befinden sich aufgrund der Globalisierung und der sich abzeichnenden demographischen und strukturellen Veränderungen in einer tief greifenden Umbruchphase. Die neuen Herausforderungen machen auch vor den Bereichen "Wohnen" und "Stadtentwicklung" nicht Halt. Die aktuelle Reformdebatte in Deutschland unterstreicht die Notwendigkeit, sich frühzeitig auf neue Bedingungen einzustellen und die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen. Übertragen auf "Wohnen" und "Stadtentwicklung/Stadtumbau" bedeutet dies, die künftige Bedeutung und Rolle der Akteure in einem veränderten Markt- und Beziehungsgefüge möglichst präzise einzuschätzen und den Akteuren eine rechtzeitige Anpassung zu ermöglichen. Im Mittelpunkt entsprechender Anstrengungen muss aus Sicht des vhw der Bürger als Wohnkonsument stehen. Dieser muss befähigt werden, seinen objektiven und subjektiven Bedeutungszuwachs sowohl am Wohnungsmarkt als auch in die politischen Gestaltungsprozesse gleichberechtigt einzubringen. Nur so kann die künftige Funktionsfähigkeit der Märkte und der Erfolg von Stadtentwicklungs- und Stadtumbaupolitik zum Nutzen aller Beteiligten herbeigeführt werden. Faktisch wird damit dem Übergang zum "ermöglichenden und aktivierenden Staat" auch im Wohnungsbereich der Weg geebnet.
Beiträge
Erschienen in
Durch ökonomische, gesellschaftliche und demographische Umbrüche werden Wohnungsunternehmen vor immer neue Herausforderungen gestellt. Die Wünsche der Kunden bezogen auf die Wohnung, das nähere Wohnumfeld und die gesamte Quartiers- bzw. Stadtteilsituation bekommen immer stärkeres Gewicht, da entspannte Wohnungsmärkte breiten Bevölkerungsschichten neue Möglichkeiten bei der Stadtteil- und Wohnungswahl erlauben. Wohnungsunternehmen können über ein Engagement im eigenen Bestand hinaus einen elementaren Beitrag zur Gestaltung des Stadtteillebens leisten. In der integrierten Stadt(teil)erneuerung sind sie schon lange wichtige Akteure. Um den Dialog über wohnungswirtschaftliche und städtebauliche Ansätze zu forcieren und ihre Zusammenführung zu unterstützen, wurde vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS NRW) in Zusammenarbeit mit der Landesentwicklungsgesellschaft Arbeitsmarkt und Strukturentwicklung (LEG-AS) die Fachgesprächsreihe "Wohnungsunternehmen als Akteure in der integrierten Stadt(teil)entwicklung" initiiert.
Beiträge
Erschienen in
Als Vorläufer der zu erwartenden gesamtdeutschen Entwicklungen ist das Ruhrgebiet ein "Laboratorium" des demographischen Wandels. Nicht zuletzt durch die seit langer Zeit anhaltende Abwanderung von Erwerbstätigen und ihren Familien ist das Ruhrgebiet vergleichsweise schnell "gealtert". Die Bevölkerungsverluste werden zu erheblichen Nachfragerückgängen und zu Einbußen der kommunalen Finanzausstattung führen, die die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Ruhrgebiets weiter verschlechtern könnten. Zu befürchten ist außerdem, dass sich in der kommenden "Schrumpfungsphase" die bereits vorhandenen sozioökonomischen Ungleichgewichte innerhalb der Region verstärken werden. Der Beitrag beleuchtet die spezifischen Hintergründe des demographischen Wandels in der Ruhrregion. Analysiert werden die Wirkungszusammenhänge zwischen den zu erwartenden Segregationsprozessen, der Innovationsfähigkeit und dem regionalen Wirtschaftswachstum der Region.
Beiträge

Erschienen in
Mit dem Ende des Wohnungsbaubooms der frühen 1990er Jahre sind die Wohnungsmärkte nicht nur in einen konjunkturellen Abschwung sondern auch in eine neue strukturelle Phase getreten. Unter den Bedingungen des demographischen Wandels bildet sich vielerorts ein Nachfragermarkt heraus. In diesem Markt wird die durch Wirtschaftsentwicklung und Suburbanisierung angestoßene räumliche Dynamik zu einer wichtigen Triebkraft der Entwicklung der Wohnungsmärkte und zum Motor der Neubautätigkeit werden.
Beiträge
Erschienen in
Die fortschreitende Globalisierung, der europäische Integrationsprozess und neue Informations- und Kommunikationstechnologien haben den internationalen Standortwettbewerb verschärft. Ob Standorte im internationalen Wettbewerb um Firmen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte erfolgreich sind, hängt von ihren Standortbedingungen ab. Im Folgenden wird dargestellt, welche Standortfaktoren in neueren ökonomischen Theorien der neuen Standorttheorie und der neuen Wachstumstheorie wesentlichen Einfluss auf die regionale Entwicklung nehmen. Hierbei wird begrifflich nicht zwischen Regionen und Standorten unterschieden, weil auch die betrachteten Theorien bezüglich dieser Begriffe keine inhaltliche Abgrenzung treffen.
Beiträge
Erschienen in
Die öffentlichen Haushalte sind leer, die sozialen Sicherungssysteme in der Krise. Private Altersvorsorge wird in Zukunft unvermeidlich zu einem Grundpfeiler der Sozialpolitik werden. Als geradezu "klassische" Form der privaten Altersvorsorge muss das selbstgenutzte Wohneigentum gelten. Insofern sind die Pläne der Bundesregierung zur Kürzung der Wohneigentumsförderung problematisch – sollten sie umgesetzt werden, ist mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen.
Beiträge

Erschienen in